Während mir die Darstellungen von Erik Hoel zur intrinsischen Perspektive durchaus plausibel erscheinen, klingen sie doch auch sehr nach der mittlerweile widerlegten Sapir-Whorf-Hypothese, dass wir nur die Dinge denken und fühlen können, für die wir auch eine Sprache haben. Eine Lösung für diesen Widerspruch könnte darin zu finden sein, zwischen einem individuellen Denken und einem kollektiven oder zumindest externalisierten Denken zu unterscheiden.
Sapir-Whorf kann meines Verständnisses nach auf der individuellen Ebene als widerlegt gelten, für einen gewichtigen Aspekt des Denkens braucht es jedoch eine Externalisierung von Gedanken und Gefühlen, damit sie anderen zugänglich gemacht werden können – und die wichtigste dieser Formen ist nun mal die Sprache.
Das gilt zum einen für das Denken mit Werkzeugen, das wie Andy Clark herausarbeitet, schon lange eine zentrale Rolle spielt. Nur wenn wir interne mentale Zustände in Begriffe oder zumindest Symbole oder andere „Äußerungen“ fassen können, sind sie dem Denken mit Werkzeugen zugänglich, das uns eine andere Dimension der kognitiven Verarbeitung eröffnet. Je präziser das entsprechende Symbol dabei ist, desto systematischer und universeller kann es für weitere Denkprozesse genutzt werden.
Noch relevanter ist in meinen Augen allerdings das „soziale“ Denken und die Entwicklung von „Kultur“ im weitesten Sinne. Hier haben z. B. Höhlenmalereien oder mündlich überlieferte Geschichten in der Form von Ereignisberichten einen wichtigen Anfang gemacht. Sie konnten jedoch emotionalen Gehalt nicht unmittelbar übermitteln, sondern nur versuchen, im Gegenüber eine analoge Reaktion auszulösen. Bei Menschen, die über lange Zeit eng beieinander lebten, mochte dies ausreichen, je komplexer und differenzierter die Lebensumstände wurden, desto vielfältiger wurden auch die mentalen oder emotionalen Zustände, die mit einer konkreten Situation verbunden werden. Und so braucht es Symbole als Intermediäre, die eine Kommunikation erlauben wie: „Wenn ich einen Bären sehe, habe ich dasselbe Gefühl, das du hast, wenn du ein Unwetter dräuen siehst“.
Nur dann kann sich ein gemeinsames Verständnis von Emotionen entwickeln und eine differenzierte „interne Perspektive“, wie wir sie heute kennen, ausbilden. Es entsteht ein Vokabular, auf das alle Menschen einer Sprachgemeinschaft zurückgreifen können und das es ihnen erlaubt, innere Prozesse und Zustände explizit zu machen und sozial zu verhandeln – sei es in intensiven Zwiegesprächen oder auf öffentlichen Foren. Vor diesem Hintergrund wäre es wenig überraschend, wenn die literarische Form des Romans hier wichtige Entwicklungshilfe geleistet hätte.





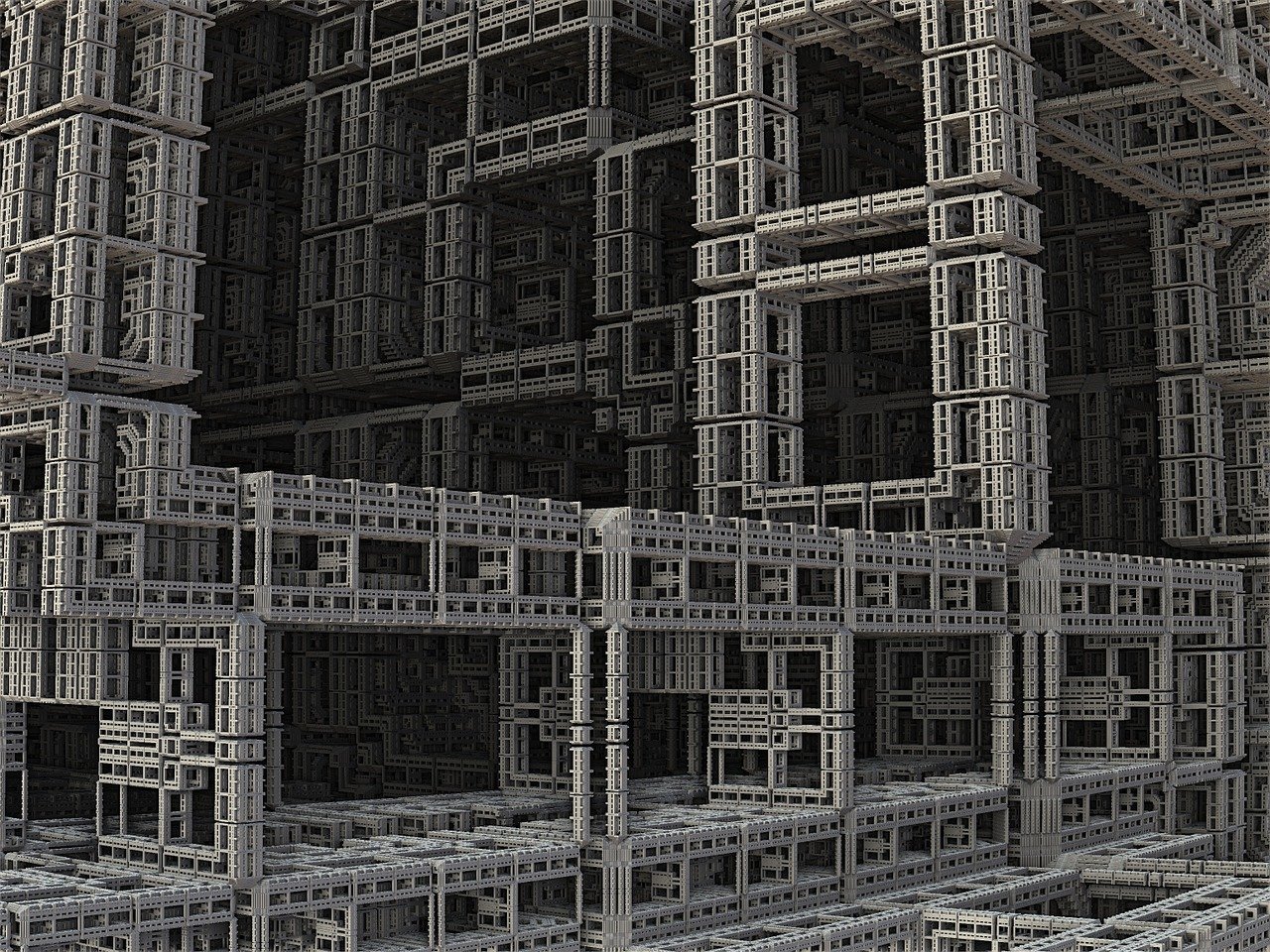
Artikel, die auf diesen Text verweisen
Kommentare
@weltenkreuzer.de
Könnte auch interessante sein.
https://www.formwelt.io/